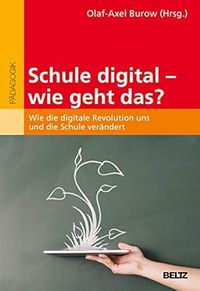Das pädagogische Konzept der Deutschen Schule Tunis
„Tatsächlich haben wir im Laufe unseres 20. Jahrhunderts einen enormen Quantitätssprung und zugleich einen enormen Qualitätssprung […] miterlebt.
Insgesamt ist die Welt des Jahres 2000 von der Welt des Jahres 1900 weit stärker verschieden, als etwa der Unterschied gewesen ist zwischen der Welt des Jahres 1900 und der des Jahres 1800“
Helmut Schmidt
Deutscher Bundeskanzler (1974 - 1982)
Bundesarchiv, B 145 Bild-F048808-0011 / Wienke, Ulrich / CC-BY-SA 3.0
„Wir erleben derzeit mit der fortschreitenden Digitalisierung fast aller unserer Lebensbereiche die Vorboten eines umfassenden Wandels, der dabei ist, unsere Gesellschaft so sehr zu verändern, dass Visionäre mit guten Gründen von einer Revolution sprechen.
Unsere moderne Welt ist großen Veränderungen ausgesetzt, die sich in nahezu sämtlichen Aspekten unseres Lebens niederschlagen. Als Reaktion hierauf entstehen fast täglich neue Trends und Technologien, insbesondere in den für die heutige Zeit besonders relevanten Bereichen der Telekommunikation, des Transportwesens, des grenzüberschreitenden Handels, der Freizeitgestaltung, des Konsums, der persönlichen Lebensführung, des menschlichen Miteinanders und des beruflichen Wandels. Unsere Schülerinnen und Schüler können sich in unserer modernen Welt nur dann ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend einbringen, erfolgreich an ihr teilhaben sowie zielorientiert mit ihr interagieren, wenn sie im schulischen Umfeld explizit auf diese Herausforderungen vorbereitet werden.
Das System Schule in seiner heutigen Form bildet dies jedoch nur in den wenigsten Fällen ab - zu sehr sind die Pädagogik und Didaktik, die Bildungsministerien und das Lehrpersonal in tradierten Rollenmustern und Vorstellungen von Unterricht verhaftet. Ein Klassenraum in den 1950er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unterscheidet sich kaum von dessen heutigem Erscheinungsbild - sieht man davon ab, dass die Möbel höchstwahrscheinlich moderner und bequemer geworden sind und die traditionelle Kreidetafel vielerorts einem Smartboard gewichen ist, wenn auch letzteres nicht immer auch entsprechend seiner technischen Möglichkeiten zum Einsatz kommt.
Das pädagogische Konzept der Deutschen Schule Tunis basiert auf dem Selbstverständnis, den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, um diesen komplexen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Verantwortung hierfür erwächst aus unserem Leitbild, welches das Fundament sowohl unseres Bildungs- als auch unseres Erziehungsauftrags bildet.
Um dieser Selbstverpflichtung angemessen gerecht zu werden, stehen die Schülerinnen und Schüler an der Deutschen Schule Tunis im Zentrum schulischer Bildung und Erziehung. Dieser Ansatz basiert auf der grundsätzlichen Annahme, dass sich Lernprozesse nur im Wechselspiel von Freiheit und Verantwortung erfolgreich entfalten können. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, einen verantwortungsvollen Umgang mit der ihnen geschenkten Freiheit zu erlernen und hierbei ein Selbstverständnis von Verantwortung zu entwickeln, welches ihnen die eigenständige Gestaltung ihrer Lernprozesse ermöglicht.
So sieht das pädagogische Konzept der Deutschen Schule Tunis beispielsweise vor, dass die Schülerinnen und Schüler die Freiheit haben, sich zwischen mehreren Zugängen zu den Lerninhalten zu entscheiden: abhängig von persönlichem Interesse, dem individuell empfundenen Schwierigkeitsgrad einer Thematik oder dem jeweils aktuellen Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Hieraus erwächst jedoch auch eine Verantwortung für sie selbst, denn nur wenn diese Entscheidung in dem vollen Bewusstsein darüber getroffen wird, dass eigene Bedürfnisse durch die Belange und Anforderungen der Außenwelt begrenzt werden, können sich Lernprozesse optimal vollziehen und die Grundpfeiler für eine zielorientierte Interaktion mit der Welt gelegt werden.
Um diese herausfordernden Zielsetzungen zu erreichen, wurden folgende Rahmenbedingungen von Unterricht an der Deutschen Schule Tunis vollkommen neu definiert:
Raumkonzept
„Schule ist heute aber noch immer ein mehr oder minder geschlossener Raum, der von der realen Lebenswelt isoliert wird, sodass sich Schule als pädagogischer Machtraum darstellt. Das bedeutet, dass entweder die Kinder und Jugendlichen zu einer Weltflucht gezwungen oder im regelpädagogischen Sinn kaserniert werden sollen. In diesen Raumentwürfen wird an der Einschließung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Raum […] festgehalten.“
(Stangl, Lernlandschaft - Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik)
Photo by Allison Shelley for EDUimages
- offene Lernlandschaften anstelle geschlossener Klassenräume.
- altersgerechte, nach Jahrgangsstufen differenzierte Gestaltung.
- der teiloffene Raum übernimmt die Funktion eines weiteren Pädagogen.
- ein zentraler "Marktplatz" lädt zu Gruppen- und Projektarbeit ein.
- Unterrichtsstunden finden in teiloffenen, verglasten Räumen statt.
- abgegrenzte und ruhige Rückzugsorte laden zu Einzelarbeit ein.
Lehrerinnen und Lehrer
„Der Paradigmenwechsel steht als Schlagwort bei der Diskussion um Änderungsprozesse in der Schule ständig im Raum. Die Art und Weise, wie Lernen definiert wird, steht dabei genauso zur Diskussion wie die Rolle, die Lehrende und Lernende im Lernprozess einnehmen. Das Bild vom "Lehren" als didaktisch aufbereitete Weitergabe von Wissen wird heute immer mehr in Frage gestellt und mit der Veränderung des Begriffs ändert sich auch die Rolle, die den Lehrenden zugewiesen wird."
(https://lehrerfortbildung-bw.de)
- wandeln ihre Lehrerolle von zentralen Wissensvermittlern zu
dezentralen Lernbegleitern.
- unterstützen individuelle, aktive Lernprozesse.
- tauschen sich regelmäßig im pädagogischen Team aus.
- entwickeln Freiarbeitsmaterialien und stellen diese bereit.
- geben wertschätzende, lernfördernde Rückmeldungen.
- gestalten eine angenehme und kommunikative Atmosphäre.
Photo by Allison Shelley for EDUimages
Schülerinnen und Schüler
„Als Schüler selber beim Lernen aktiv zu sein ist gut, selber über sein Lernen mitzubestimmen ist noch besser, selber sein Lernen zu steuern und zu regulieren, ist am besten."
(Herbert Gudjons, Neue Unterrichtskultur - Veränderte Lehrerrolle)
Photo by Allison Shelley for EDUimages
- übernehmen Verantwortung und gestalten ihre Lernprozesse selbst.
- entwickeln Selbstdisziplin und organisatorische Kompetenzen.
- vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und haben keine Angst vor Fehlern.
- lernen, ihre eigene Leistung kritisch zu reflektieren.
- erwerben soziale Kompetenzen wie Empathie und Teamfähigkeit.
- speichern selbständig erarbeitetes Wissen nachhaltig im Gedächtnis ab
und transferieren dieses auf die Lebenswirklichkeit.
Unterrichtsmaterial
„Mit Hilfe von speziellem Arbeitsmaterial sollen Interessen ohne allzu starke Eingriffe seitens des Pädagogen gelenkt und die Entwicklung des Kindes somit beschleunigt werden."
(PD Dr. Alfred Riedl, Lehrstuhl für Pädagogik, Technische Universität München)
- das Material übernimmt die Funktion eines weiteren Pädagogen.
- es animiert zum Nachdenken, Experimentieren, Ausprobieren und
individuellen Lösen von Fragestellungen.
- es ist haptisch ansprechend und methodisch-didaktisch durchdacht.
- es ermöglicht eine Selbstkontrolle in unterschiedlichen Arbeitsstadien.
- es beinhaltet verschiedene Lernzugänge, die alle Sinne ansprechen.
- es ist lebensnah und anwendungsbezogen konzipiert.
Photo by Allison Shelley for EDUimages
Schulorganisation
Freies Arbeiten, offene Lernformen und die Freizügigkeit der Lernlandschaften stellen hohe Anforderungen an die Schulorganisation. Diese muss so konzipiert sein, dass sie die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, ihre Lernprozesse in Freiheit und Verantwortung selbst zu gestalten. Sie gibt einen verbindlichen Orientierungsrahmen insbesondere auch für diejenigen vor, welchen es nicht immer leicht fällt, verantwortungsbewusst mit der ihnen geschenkten Freiheit umzugehen.
Photo by Allison Shelley for EDUimages
- eine speziell auf die pädagogischen Belange abgestimmte Tagesstruktur.
- Einfordern und Einhalten von gemeinsamen Regeln.
- Vereinheitlichung von Anforderungs- und Bewertungskriterien.
- Bedeutsamkeit von Selbstkompetenz (Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordentlichkeit, Selbstbeherrschung, Selbständigkeit).
- der digitale Schreibtisch dient als gemeinsame Arbeitsgrundlage.
- Angebot von Spezialstunden (z. B. Intensivierung, Kompetenztraining...)